Neurologin Andrea Maier & Med. Behandlung auf Augenhöhe: Episode 7, Aches, Pains & Smiles
In Episode 7 meines Podcasts Aches, Pains & Smiles spreche ich mit Dr. Andrea Maier, Neurologin an der Uni Aachen und Expertin für die Ehlers-Danlos-Syndrome, autonome Neuropathies und Small-Fiber-Neuropathie. Mit Andrea spreche ich über ihre jahrelange Erfahrung in der Behandlung von Menschen mit EDS, wie sie es schafft mit ihren Patient*innen immer auf Augenhöhe zu arbeiten und wie man die Kommunikation zwischen Mediziner*innen und deren Patient*innen verbessern kann.
Intro:
[Andrea]
Ich habe auch sehr schnell gemerkt, dass viele psychiatrische Diagnosen die Zeit vor der Diagnose begleitet haben. Ich war doch überrascht, wie häufig auch Fehldiagnosen, keine Diagnosen oder psychosomatische Ursachen dann vermutet worden sind. Und das höre ich eigentlich mittlerweile im Alltag bei fast allen Patienten.
[Musik]
[Karina]
Hey, schön, dass Ihr wieder reinhört in Aches, Pains & Smiles! Mein Name ist Karina Sturm, ich bin ehemalige medizinisch-technische Assistentin und heute Journalistin, die sich ab und an auch im Bereich Dokumentarfilmen ausprobiert. Mit meiner Arbeit gebe ich Menschen mit den verschiedensten chronischen Krankheiten und Behinderungen eine Plattform. Außerdem lebe ich selbst mit einer meist unsichtbaren Behinderung aufgrund einer angeborenen Bindegewebserkrankung, dem Ehlers-Danlos-Syndrom. Gemeinsam mit meinen Gäst*innen möchte ich mit den typischen Vorurteilen gegenüber chronisch kranker und behinderter Menschen aufräumen und gleichzeitig Berührungsängste zwischen behinderten und nicht-behinderten Menschen abbauen.
In der heutigen Episode machen wir mal was Neues. Zum ersten Mal spreche ich mit einer Mediziner*in. Mit der wunderbaren Dr. Andrea Maier. Andrea ist Fachärztin für Neurologie, forscht zum Thema Ehlers-Danlos-Syndrome, autonomen Neuropathien und Small-Fiber-Neuropathie und betreut Patient*innen mit (hypermobilem) EDS – dadurch kennen Andrea und ich uns auch schon eine Weile. Andrea ist außerdem als Expertin im medizinisch-wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Ehlers-Danlos Initiative e. V. sowie POTS und andere Dysautonomien e. V. Aktiv. Heute spricht sie mit mir darüber, wie man die Kommunikation zwischen Ärzt*innen und ihren Patient*innen auf beiden Seiten verbessern kann.
Karina Sturm:
Hallo liebe Andrea, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute bei mir im Podcast bist. Du bist ja eine der wenigen Ärzt*innen im Bereich seltene Bindegewebserkrankungen, also genauer Ehlers-Danlos-Syndrome, in Deutschland, die sich wirklich richtig, richtig gut auskennen und für uns Patient*innen kämpfen. Magst du mir zum Einstieg mal erzählen, wie es gekommen ist, dass du gerade in dem Bereich zu EDS und dessen Begleiterkrankungen gelandet bist.
Dr. Andrea Maier:
Ja, hallo liebe Karina. Also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Das freut mich sehr. Wie bin ich dazu gekommen? Das ist ein bisschen ein komplizierter Weg, würde ich sagen. Ich habe Medizin studiert, weil mich Medizin immer schon sehr interessiert hat. Und im Medizinstudium wollte ich immer gerne in die innere Medizin, habe dann aber mein PJ in der Neurologie gemacht und in der inneren Medizin und festgestellt, dass die Neurologie tatsächlich ein super spannendes Fach ist, wo man ganz viel innere Medizin und auch andere Fächer mit vereint. Und so bin ich in die Neurologie gekommen und habe in der Zeit auch in meinem PJ bei uns die autonome Funktionsdiagnostik kennengelernt, also Kipptischuntersuchungen, Schweißtestungen und das fand ich super spannend, das hat mich interessiert. Und als ich dann bei uns im Krankenhaus meine Facharztausbildung angefangen habe, da habe ich auch von Anfang an in der autonomen Sprechstunde angefangen, Patienten zu sehen und habe dann mit meiner damaligen Kollegin, die ANS-Ambulanz aufgebaut. Und dann kam es eigentlich relativ schnell, dass die erste Patientin damals mit Ehlers-Danlos-Syndrom sich auch gemeldet hat. Weil ja viele Patienten mit Ehlers-Danlos-Syndromen autonome Störungen, Kreislaufstörungen haben. So bin ich dann auch zu den Ehlers-Danlos-Syndromen gekommen. Wie das dann so ist, wenn man eine Patientin hat, dann kommt die nächste. So ist es dann immer weitergegangen. Und ich habe in dem Bereich autonomes Nervensystem und dann besonders Ehlers-Danlos-Syndrome dann einfach immer mehr Patientinnen gesehen.
Sturm:
Es ist witzig, dass du sagst, wenn du halt eine hast, dann kommen immer mehr. Das ist tatsächlich dank unserer Community, weil die so klein ist in Deutschland. Das spricht sich rum wie ein Lauffeuer, wenn da eine Ärztin besonders gut ist. Da kam im Endeffekt dein Name auf und ab überall. Es war so wie, okay, ich brauche eine Diagnose für POTS und Dysautonomie-Testungen, wo kann ich da hin? Und es war überall immer nur derselbe Name. Und das war deiner.
Maier:
Es gibt halt in Deutschland einfach so wenige autonome Ambulanzen beziehungsweise es gibt autonome Funktionslabore. Aber dann war halt in Aachen so die erste Ambulanz, die gesagt hat, wir behandeln die Patienten auch. Wir sehen die, wir beraten die und wir machen nicht nur Diagnostik. Und dadurch ist das, glaube ich, gekommen. Und ja, das ging total schnell. Und wie das dann so ist, man kann natürlich nicht so schnell etwas aufbauen und man ist kapazitär begrenzt. Aber die Patientinnen, die ich sehe, die versuche ich dann natürlich von vorne bis hinten so gut zu betreuen, dass sie dann auch heimatnah wieder weiter versorgt werden können.
Sturm:
Als du angefangen hast mit der ANS-Ambulanz, hattest du da schon irgendeine Art von Wissen zu den Ehlers-Danlos-Syndromen oder war das praktisch alles noch neu?
Maier:
Also das ist bei uns im Studium eine Vorlesung in der Genetik. Und Ehlers-Danlos-Syndrome kommen da, glaube ich, in zwei Folien vor. Und so viel weiß man als Ärztin…
(Lachen)
Sturm:
Ja, da passt bestimmt nicht viel drauf auf die zwei Folien.
Maier:
Ja, genau. Vielleicht waren es auch drei. Aber klar, natürlich wusste ich, was heißt Ehlers-Danlos-Syndrom. Ich wusste, die Menschen sind sehr überbeweglich. Die haben sehr dehnbare Haut. Ehlers-Danlos-Syndrom, Marfansyndrom, also das sagte mir was. Aber mir waren natürlich die ganzen Komorbiditäten und so nicht klar. Ich wusste, dass POTS häufig ist bei Patientinnen mit Ehlers-Danlos-Syndrom. Das habe ich natürlich auch sehr schnell gelesen und erfahren, weil man sich ja auch immer fragt, warum haben die Patientinnen die Beschwerden. Aber ich habe, glaube ich, bis zu meiner wirklichen Arbeit in der Neurologie, kann ich mich nicht erinnern, dass mir eine Kollegin so auf Station mal gesagt hätte, hier, ich habe eine Patientin mit Ehlers-Danlos-Syndrom.
Sturm:
Also du bist im Endeffekt ganz zufällig da reingerutscht und dann haben wir dich als Community gezwungen, dich weiter mit zu beschäftigen.
Maier:
Nein, nein, nein. Also gezwungen wurde ich nicht. Bei mir ist es so, wenn ich etwas kennenlerne, was ich nicht kenne, dann lese ich mich da rein. Und wenn ich das spannend finde, dann versuche ich von Patientinnen auch zu lernen und zu schauen. Und dann sieht man ganz schnell die Muster und dann sieht man ganz schnell, dass nicht der eine Patient allein sein Problem hat, sondern dass viele Patientinnen ganz ähnliche Probleme haben. Und so ist das bei mir passiert.
Sturm:
War dir damals bewusst, wie, ich sag mal, verzweifelt wir Patientinnen teilweise auch sind und wie arg wir genau jemanden wie dich gebraucht haben?
Maier:
Das war mir nicht so bewusst. Ich hab das schon gemerkt bei den autonomen Neuropathien, weil ich einfach auch im Kolleginnenkreis gemerkt hab, dass es keiner kennt. Und dass die Beschwerden oft ja auch, wenn sie nicht ganz dramatisch sind, wie bei schweren autonomen Neuropathien, dass die halt gerade bei den Kreislaufstörungen oft sehr unspezifisch sind. Und mir war schon klar, dass die Versorgung nicht die beste ist. Aber in den letzten Jahren habe ich doch sehr viel mitbekommen, was die Versorgungssituation von Patient*innen mit seltenen Erkrankungen angeht. Nicht nur Ehlers-Danlos-Syndrome, auch andere seltene Erkrankungen. Und da ist mir immer mehr bewusst geworden, wie schwierig es ist, wenn man nicht sehr bekannte Erkrankungen hat, dann auch wirklich eine gute Versorgung zu bekommen. Und in dem heutigen System in Deutschland auch Hausärztinnen beispielsweise zu haben, die einen auch dauerhaft gut betreuen und behandeln können und so ein bisschen die Fäden zusammenhalten.
Sturm:
Du hörst ja bestimmt bei dir auch ganz oft von ziemlich schweren Krankheitsverläufen. Also gerade so die Patienten, die eben mit vielen komorbiden Erkrankungen von EDS kommen, die sind ja meistens die, die auch am komplexesten sind. Ich gehe davon aus, dass du wahrscheinlich auch von relativ vielen weiblichen Patientinnen gehört hast, dass sie ganz viele Fehldiagnosen erhalten haben, bevor sie die EDS-Diagnose bekommen haben. Kannst du mir mal einen kleinen Einblick in deinen Arbeitsalltag geben? Was erzählen dir deine Patienten in Bezug auf diese Diagnose?
Maier:
Also, was ich ganz oft erfahre, ist der Satz: ”Ich bin so glücklich, dass ich endlich hier bin.“
(Lachen)
Oder am Anfang war das auch oft so: ”Ich bin so froh, dass mir jemand zugehört hat.” Das war das, was ich am Anfang oft gehört habe. Ich höre mir normalerweise in dem ersten Teil des Gesprächs der Anamnese mit den Patientinnen an, was sie für eine Vorgeschichte haben. Und habe natürlich schnell gemerkt, dass die Vorgeschichte sehr lang ist. Und habe auch sehr schnell gemerkt, dass viele psychiatrische Diagnosen die Zeit vor der Diagnose begleitet haben. Und war doch überrascht, wie häufig auch Fehldiagnosen, keine Diagnosen oder psychosomatische Ursachen dann vermutet worden sind. Und das höre ich eigentlich mittlerweile im Alltag bei fast allen Patientinnen. Ich habe natürlich auch Patientinnen, wo wir im Team dann selber sagen, es könnte ein Ehlers-Danlos-Syndrom sein, das kommt auch vor. Aber meistens kommen diagnostizierte Patientinnen oder welche, die sagen, ich glaube, ich habe EDS und die schon eine lange Vorgeschichte hatten, mit langem Leidensweg, im Hinblick auf die Diagnosestellung, die Diagnostik. Aber vor allem, und das ist das, was ja auch so schwierig ist heute noch, die Therapie.
Sturm:
Mhm. Ja, ich meine, da gibt es in Deutschland ja nur ganz begrenzt Anlaufstellen überhaupt. Das ist ein Riesenproblem mit Diagnostik, Therapie – eigentlich allem, wenn man ehrlich ist. Was macht das mit dir, wenn du solche Geschichten hörst den ganzen Tag? Also ich gehe davon aus, du hast ja mittlerweile wahrscheinlich sehr viele EDS-Patienten in deiner Sprechstunde. Wenn du ständig solche komplizierten und auch teilweise wahrscheinlich traurigen Geschichten hörst, was macht das mit dir als Medizinerin, aber auch als Privatperson?
Maier:
Naja, ich arbeite ja jetzt seit 2018 wirklich nur noch mit schwer mehrfach betroffenen Patientinnen. Seit ich im Medizinischen Zentrum für erwachsene Menschen mit Behinderung arbeite, ist eigentlich jeder Tag davon geprägt, dass ich Patientinnen betreue, die mehr oder weniger stark betroffen sind. Aber jeder Mensch ist anders, jeder Mensch ist individuell. Sodass ich auch bei jedem neuen Patientin, der vor mir ist oder mit seiner Begleitung kommt, immer wieder eine neue Geschichte höre. Und das … Also, was macht das mit mir? Es macht mich im Alltag dankbarer, würde ich sagen. Ich bin, seitdem ich wirklich auch … schon vorher, als ich in der Neurologie gearbeitet habe, aber seitdem ich tagtäglich nur noch mit sehr komplexen Fällen arbeite, bin ich im Alltag dankbarer. Ich bin offener, auch für die Hürden, die es im Alltag gibt. Bspw. wenn ich durch die Stadt gehe und unser Kopfsteinpflaster hier in Aachen sehe. Oder einkaufen gehe und merke, hier mit einem Elektrorollstuhl durchzukommen, ist also ganz schön schwierig. Das hat mich schon verändert. Aber ich würde sagen, dass ich im Alltag viel mehr auf Dinge achte. Und auch das, was ich selber kann und was mir selber möglich ist, wertschätze auf eine andere Art und Weise.
Sturm:
Ja, solche Sachen fallen anderen Leuten wahrscheinlich auch gar nicht auf. Also gerade so die Sache mit Barrierefreiheit. Das ist, glaube ich, was, was man eigentlich sonst gar nicht so wahrnimmt, wenn man da nicht den Kontakt hat zu so vielen Menschen.
Maier:
So ist das, ja. Aber ich versuche auch, zu kommunizieren darüber. Also im Freundeskreis, im Bekanntenkreis auch wirklich zu sagen, was ich mache, was ich auch manchmal für Schwierigkeiten sehe im Alltag. Und ich finde, auch das ist dann ein gutes Gefühl zu sehen. Also man kann im eigenen Kreis etwas tun, man kann Awareness schaffen. Und auch bei den Patientinnen. Also ich erlebe jeden Tag richtig positive Erlebnisse, wenn ich höre von Patientinnen, dass sich deren Situation verbessert hat. Und das mag ich am meisten an meiner Arbeit. Mit dem, was wir tun, können wir, auch wenn das kleine Dinge sind, durch Hilfsmittelversorgung, durch Rezepte, die man verschreibt, einfach dann auch helfen. Und deswegen bin ich auch Arzt geworden.
Sturm:
Ja, wobei du machst, also meiner Meinung nach, sehr viel mehr als ganz, ganz viele andere Mediziner. Also du gehst schon auch immer irgendwie ein Stückchen weiter. Auch die Sache, dass du dich privat engagierst in Organisationen, damit die Versorgungssituation tatsächlich besser wird für die Patienten und so, das ist ja nicht selbstverständlich. Also das, finde ich, geht schon über das hinaus, was man jetzt von einer Ärztin erwarten würde.
Maier:
Ja, ja, das ist unterschiedlich. Ich glaube, viele engagieren sich auch in verschiedenen Bereichen. Das ist auch wichtig. Sonst würde es ja auch die Selbsthilfe gar nicht so in dem Ausmaß geben oder auch Berufsverbände.
Sturm:
Ja. Und wie wie unterstützt du deine Patientin sonst noch? Also du hast jetzt schon gesagt mit Hilfsmittel, Rezepten und sowas. Aber was machst du sonst, um die Lebenssituation zu verbessern?
Maier:
Also man muss ein bisschen unterscheiden von wo ich gerade tätig bin. Wenn ich in der autonomen Ambulanz Patientinnen sehe, geht es meistens darum, erst mal die Diagnose zu stellen. Das heißt, die Anamnese zu erheben, den Patienten ausführlich zu untersuchen. Und dann auch die Vorgeschichte zu erfassen. Und zu schauen, was ist jetzt das Problem? Und auch die Ursache zu finden. Das ist häufig Detektivarbeit, wo man dann auch mit den anderen Zentren, zum Beispiel bei uns mit den Kolleginnen vom Zentrum für Seltene Erkrankungen, zusammenarbeitet. Und ich glaube, dass man da schon hilft, indem man eine Diagnose stellt und einen Arztbrief verfasst, in dem dann auch die entsprechenden Therapieempfehlungen, die dann im ambulanten Rahmen, heimatnah, fortgeführt werden können drinstehen. Das ist so der eine Punkt. Die ärztliche Diagnose und Therapieempfehlungen. Und im MZEB, wo ich ja Patienten mit schwerer Mehrfachbehinderung sehe, da habe ich dann noch das Glück, auch Therapeutinnen, Sozialarbeiter, Psychologen und auch tatsächlich Kolleg*innen anderer Fachdisziplinen auch der Orthopädie zu haben. Und dann auch im Team gemeinsam einmal zu schauen, was ist denn los bei dem Patienten? Das dauert dann auch häufig mal über zwei, drei Termine. Das kann man nicht alles in einem Termin erfassen. Aber da zu schauen, wie ist die Situation zu Hause, welche Hilfsmittel werden benötigt? Hat jemand einen Grad der Behinderung? Hat jemand einen Pflegegrad? Und da dann zu beraten, zu unterstützen. Und zwar auch mit dem Backup des Teams, was sich damit auskennt. Weil das ist ja für mich als Ärztin nicht gerade Alltag, in Sachen Pflegegrad und Behindertenausweis zu beraten. Aber da habe ich dann Kolleginnen, die das können. Und das ist dann so die andere Ebene, in der wir sozialmedizinisch-therapeutisch beraten, Hilfsmittelberatung machen. Und dann auch wieder was mitgeben können, auch an die Hausärztinnen, an die niedergelassenen Kolleginnen.
Sturm:
Ich finde das super, vor allem weil gerade diese ganzen sozialrechtlichen Fragestellungen unfassbar schwer zu navigieren sind, vor allem, wenn man chronisch krank ist und mit chronischen Schmerzen lebt. Das ist eine ziemlich große Herausforderung. Wenn einen da einer an die Hand nimmt und sagt, so und hier ist der Antrag und den musst du da einreichen und diese Frist und so, dann ist das so unfassbar viel wert auch. Ich wünsche das hätte jeder Patient ehrlich gesagt. Jetzt hast du vorhin auch schon mal kurz angeschnitten, dass du auch oft hörst von deinen Patientinnen, die bei dir in der Sprechstunde erscheinen, dass die mit psychischen Fehldiagnosen kommen. Du kennst die Zahlen ja wahrscheinlich, also Betroffene mit EDS brauchen in der Regel so 14 Jahre bis zur korrekten Diagnose und wenn man vorher eine psychische Fehldiagnose hat, verlängert sich die Zeit auf 22 Jahre. Das ist eine Studie von EURORDIS gewesen. Und beim Großteil der Patientinnen kommt es halt auch zu psychischen Fehldiagnosen und bei POTS verhält sich sehr ähnlich. Da werden ganz viele mit Angststörungen diagnostiziert, bevor sie eigentlich mit der POTS-Diagnose dann die POTS-Diagnose kriegen. Wieso, glaubst du, werden vor allem, also meiner Meinung nach vor allem weibliche Patientinnen mit komplexen Erkrankungen wie EDS oder POTS so oft als psychisch krank eingestuft?
Maier:
Bleiben wir vielleicht mal beim POTS. POTS ist ja eine Kreislaufstörung. Das heißt, die Betroffenen haben, wenn sie stehen, Herzrasen, verschwommen sehen, Herzrasen, Herzrasen und noch mal Herzrasen. Und das sind Symptome, die zum Beispiel auch bei Patientinnen mit Angststörung auftreten können. Ja, also man fängt an zu schwitzen, man zittert, man hat Herzrasen, man ist ängstlich. Und um das POTS zu diagnostizieren, muss man eine gute Anamnese durchführen, also den Patienten dann wirklich fragen, sind die Beschwerden im Liegen, weg, und im Stehen sind sie da zum Beispiel. Und den Patienten untersuchen. Und wenn da in dem Zeitdruck, würde ich auch mal sagen, den es häufig gibt in den Praxen, einfach die Anamnese zu kurz kommt, Patientinnen kommen aber immer wieder mit Beschwerden, dann wird vielleicht auch in der Anamnese ein bisschen was übersehen. Dann denkt man schneller an eine Angststörung als an eine Kreislaufstörung, die wesentlich seltener bekannt ist. Ich glaube, das ist so der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist dann auch, dann kommen hinzu Magen-Darm-Beschwerden, Blasenentleerungsstörungen, Darmentleerungsstörungen. Und auch dort bedarf es einer relativ spezifischen und auch oft sehr ausführlichen Zusatzdiagnostik, um festzustellen, dass jemand beispielsweise eine Magenlähmung hat, eine Gastroparese. Wenn man eine normale Spiegelung macht, sieht man das nicht. Und es bedarf Zeit. Man muss sich die Zeit nehmen, man muss noch mal ein bisschen in die Tiefe denken. Und man muss auch ein gewisses Wissen haben. Und diese Aspekte kommen alle zusammen. Und da liegt es dann häufig nahe, wenn man nicht genau weiß, was da los ist, dann doch an psychosomatische Ursachen zu denken. Weil es halt häufig, gerade im Anfangsstadium, und wenn nicht die richtige Diagnostik gemacht wird, auch schwer zu objektivieren ist. Das ist, glaube ich, der eine Punkt. Es ist schwer zu erfassen, und ich frage mich das auch häufig, weil wenn man jeden Tag mit diesem Thema arbeitet, denkt man sich, das ist doch nicht so schwer, einmal im Liegen und stehen den Blutdruck und die Herzfrequenz zu messen. Aber es ist im Alltag wohl doch schwierig, dann sind häufige Diagnosen häufiger gestellt als seltene Diagnosen. Und das wird ein Grund sein, warum auch psychiatrische Fehldiagnosen vorliegen. Es sind nun mal deutlich mehr Frauen betroffen als Männer, sowohl beim POTS als auch beim Ehlers-Danlos-Syndrom. Allein das führt dazu, dass mehr Frauen vor einem sitzen, die dann psychiatrische Fehldiagnosen haben als Männer. Ich hab auch Männer vor mir sitzen mit psychiatrischen Fehldiagnosen. Und hinzu kommt noch zusätzlich, wenn man chronisch krank ist, Beschwerden schon in der Kindheit beginnen, dann wird man auch psychiatrische Komorbiditäten entwickeln können, wenn eine gewisse Vulnerabilität da ist. Nicht jeder Mensch mit chronischen Erkrankungen entwickelt eine Depression oder vielleicht auch eine Angststörung, aber es ist trotzdem ein Teufelskreis, wenn man immer wieder zum Beispiel im Stehen den Trigger hat, dass das Herz rast, dann meidet man vielleicht irgendwann das Stehen. Und auch da kann natürlich eine gewisse Prädisposition sein, um auch dann tatsächlich auch psychiatrische Erkrankungen zu entwickeln, die aber nicht die Ursache sind für die eigentliche Erkrankung.
Sturm:
Also jetzt von meiner persönlichen Erfahrung ausgehend, und ich sage nicht, dass das bei jedem genauso ist, aber bei mir zum Beispiel war die Ursache, dass ich so eine leichte, ich würde sagen, eine leichte Angststörung entwickelt habe über die Zeit, war hauptsächlich, weil ich so viele negative Erfahrungen gemacht habe in der Zeit, wo ich eine Diagnose gesucht habe. Also dieses zu hören, das ist alles nur in deinem Kopf, das bildest du dir alles nur ein, du hast eigentlich gar nichts, reiß dich mal ein wenig zusammen und das konstant über Jahre hinweg. Ich habe irgendwann tatsächlich einfach mich selber anzweifelt, beziehungsweise Angst vor Arztterminen entwickelt, weil ich Angst hatte, dass mir wieder nicht geglaubt wird. Das ist auch halt auch so ein Kreislauf. Also das ist einerseits klar, die chronischen Schmerzen. Ich meine, ganz ehrlich, jemand der in so einem EDS-Körper gesteckt hat für Jahre, der kann, glaube ich, verstehen, warum er da eventuell eine Depression entwickelt oder Angststörungen oder irgendwas anderes, weil es einfach wirklich viel ist, mit dem man da umgehen muss. Aber dann auch gleichzeitig eben der Zusammenhang mit negativen Erfahrungen, die auch wieder die Psyche beeinflussen können. Also das ist irgendwie schon alles ein Kreislauf.
Maier:
Ja, genau, das ist es. Und nichts geht spurlos an einem vorbei. Und dann kommt es ja auch darauf an, welche persönlichen Coping-Strategien hat man in gewissen Situationen. Und auch da, es gibt Menschen, die neigen nicht zu psychiatrischen Erkrankungen und es gibt Menschen, die haben eine Prädisposition. Und wenn dann vielleicht auch noch Faktoren dazukommen, die immer wieder triggern, dann kann das natürlich passieren.
Sturm:
Ja, und ich glaube, diese Coping-Strategien lernt man auch hauptsächlich über die Zeit. Also am Anfang hat man die auch einfach noch nicht, vor allem weil diese Situation komplett neu ist und du wirst da in was reingeworfen. Ich meine, als Patientin gehe ich im Endeffekt, also als ich gesund war, bin ich zu einem Arzttermin gegangen und habe gedacht, ich kann darauf vertrauen, dass das eine Person ist, die mir jetzt hilft und die mich im besten Fall heilt. Also das ist irgendwie die Einstellung, die ich damals hatte, wenn ich bei dem Arzt war. Genau, aber dann auf einmal verliert man dieses Vertrauen, weil das eben nicht mehr das ist, was passiert. Plötzlich sitzt da jemand vor dir und du denkst ein bisschen, als wäre das dein Feind über die Zeit. Also wenn die Person dir ständig sagt, das bildest du dir alles ein, du hast nichts, dann wirst du wütend und frustriert als Patient.
Maier:
Ich berufe mich dann ja auch immer gerne darauf, was gibt es so in der Forschung Und da ist die Forschung ja auch noch ganz am Anfang, die Mechanismen da genauer zu verstehen. Ich bin sehr froh erst mal, dass ich sehe, dass sich im Bereich der Medizin viel zum Beispiel tut, im Bereich der Awareness für seltene Erkrankungen, für Ehlers-Danlos-Syndrome, auch für autonome Neuropathien. Da sind ja andere Länder jetzt auch noch mal viel weiter. Wenn man beim Ehlers-Danlos an die USA denkt oder beim POTS, da sind ja doch deutlich mehr Forschungsaktivitäten. Und ich denke, da wird sich was tun. Das wird dann hoffentlich auch dazu führen, dass auch seltene Erkrankungen häufiger an der Universität vertreten sind. Das Wissen ist explosionsartig gestiegen und das führt auch dazu, dass es mehr in den Lehrplänen verankert sein wird. Nur das hilft natürlich dem Patienten in dem Moment nicht, wenn er beim Arzt sitzt oder bei der Ärztin und das Gefühl hat, der Gegenüber nimmt meine Beschwerden nicht ganz ernst. Und das ist auch Aufgabe von uns Ärztinnen zu sagen, wenn wir auch etwas nicht wissen, also das muss ich sagen, das habe ich schon sehr früh gemacht. Also ich kann nicht alles wissen. Ich habe Grenzen. Ich kann nicht alles wissen. Das ist unmöglich. Die Medizin ist viel zu komplex. Aber das gestehe ich mir auch ein. Und dann kann man auch mal sagen, wenn man irgendwo mal nachlesen muss oder einen Kollegen fragen muss. Und das machen auch viele meiner Kolleginnen. Das sehe ich im Alltag häufig. Und das finde ich immer sehr positiv, auch mal zu sagen: Ich weiß es nicht, aber ich schaue mal nach oder ich frage mal eine Kollegin oder ich kenne da jemanden, den man fragen kann oder an den man weiterverweisen kann. Und ich glaube, das ist natürlich eine Erfahrung, die man mit so seltenen Erkrankungen sehr viel häufiger macht, dass man dann wieder von jemandem, der es nicht weiß, weil er es halt einfach nicht weiß, an jemand anderen weitergeleitet wird. Und dann hat man natürlich auch da einen sehr langen Weg von Ärztin zu Ärztin zum Nächsten und ja, auch so was verunsichert. Weil man möchte ja eine Diagnose, man möchte ja wissen, wie es weitergeht.
Sturm:
Das schon, wobei ich auch sagen muss, dass wenn mir jemand gegenüber sitzt, der ganz ehrlich sagt: “Frau Sturm, ich weiß leider nicht, was ihnen fehlt, aber ich glaube ihnen, was sie mir schildern. Und deswegen würde ich sie gerne an den und den Kollegen, die und die Kollegin weiterleiten.” Damit kann ich, also da habe ich gar kein Problem mit, weil das ist ehrlich und nicht jeder kann alles wissen, wie du ja schon sagst. Aber was ich schwierig finde, ist, wenn das dann umschlägt in ein: ”Okay, ich weiß jetzt nicht, was die hat und deswegen kann das nur psychisch sein.” Damit habe ich ein Problem. Aber zu sagen, ich weiß es einfach nicht, das ist völlig okay.
Maier:
Das ist der offene Umgang. Und das macht auch eine gute Arzt- oder Ärztinnen-Patienten-Beziehung aus, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Und auch auf beiden Seiten zu sagen, wenn man sich gerade unwohl fühlt. Wenn ein Patient mir gegenüber sagt, die Chemie mit Ihnen stimmt aber gar nicht, dann kann ich damit leben. Dann kann ich sagen, gehen Sie zu meiner Kollegin. Das möchte man als Arzt nicht hören, aber damit komme ich klar.
Sturm:
Wenn du mir das aus Ärztinnensicht sagst: Ich sitze vor einem Arzt oder einer Ärztin und schildere meine Symptome, zeige Untersuchungsergebnisse, die alle unauffällig sind. Ich weiß aber, dass es was Körperliches ist, aber mir wird schon wieder was erzählt von Depression und Psychosomatik. Was kann ich als Patientin tun, um den Arzt oder die Ärztin vom Gegenteil zu überzeugen, aber gleichzeitig auch nicht vor den Kopf zu stoßen?
Maier:
Also, ich weiß nicht, ob du das in dem Moment kannst. Ich hab da auch lange drüber nachgedacht, was kann man tun. Aber es ist ja immer schwierig, jemanden vom Gegenteil zu überzeugen. Ja, eine ganz schwierige Frage. Ich weiß es so nicht, spontan. Ich glaub, was wichtig ist, ist, wenn man als Patient, gerade wenn man sehr komplexe Erkrankungen hat, klar, dann trägt man viele Krankenakten mit sich rum. Wenn man aber beim ersten Arzt ist, finde ich, ist das aber meine persönliche Ansicht, ich finde es immer gut, wenn die Patientin die Akten dabei hat. Und die am besten chronologisch sortiert sind, sodass man als Arzt sich einen Überblick verschaffen kann. Wenn man das möchte. Wenn aber jemand vor mir sitzt, wo ich schon merke, der möchte nicht, dann kann man als Patient wenig tun, um zu überzeugen.
Sturm:
Sage ich dann einfach vielen Dank für Ihre Zeit und Tschüss und gehe quasi zum Nächsten?
Maier:
Ich glaube, ich würde dann, genau, ich glaube, ich würde an so einer Stelle, wenn ich jetzt in der Situation wäre, ich würde meine Beschwerden schildern, aber wenn ich merken würde, mein Gegenüber würde mich abstempeln, so wäre das ja auch im Alltag, wenn ich Bekannte oder so treffe und ich merke, jemand stempelt mich ab, dann kann man argumentieren, man kann versuchen, zu überzeugen. Ich denke, das ist auch nicht verwerflich, das zu versuchen, aber wenn man dann merkt man es am Punkt, wo man sich nicht ernst genommen fühlt und es nicht funktioniert, kann man das offen ansprechen. Sagen aus der Ich-Perspektive, ich fühle mich nicht ernst genommen. Oder mein Eindruck ist, ich habe psychiatrisch viel getan, ich habe Therapien gemacht, das haben viele Patientinnen, die mir das ganz offen sagen, ich habe schon Therapien gemacht. Aber das hilft mir nicht, ich glaube, das Problem sitzt woanders. Wenn ich das ernst nehme, auch als Arzt, dann sage ich, das glaube ich ihnen. Da muss man mal schauen, was man da machen kann, oder ob es eine andere Möglichkeit gibt. Aber wenn jemand das nicht möchte, oder man das Gefühl hat, man wird abgelehnt, ist es auch schwer, etwas dagegen tun zu können.
Sturm:
Mhm. Das ist halt das, wo sich der ganze Frust anstaut. Das sind die Termine, wo man viele negative Erlebnisse hat und die dann von einem Arzt zum nächsten trägt. Wie schwierig ist es denn für eine weibliche junge Ärztin sich für Patientinnen mit so komplexen Multisystemerkrankungen einzusetzen. Und glaubst du, macht es einen Unterschied, ob eine junge weibliche Ärztin das macht versus ein älterer, männlicher Arzt?
Maier:
Also ich habe da ehrlich gesagt wenig darüber nachgedacht, weil ich bin so ein Mensch, ich mache einfach. Und wenn ich in der Situation bin und mein Gefühl sagt mir, das macht Sinn, sich da einzusetzen, bei Selbsthilfegruppen mitzumachen, dann mache ich das. Und dann versuche ich, in dem Rahmen das Beste zu tun, was ich kann. Aber ich muss auch meine Grenzen kennen, wenn ich mal nicht kann. Und ich bin… Also der ärztliche Beruf wird weiblicher, das ist korrekt. Und bei mir im Studium war auch schon eine sehr hohe Frauenquote. Das hat auch in den letzten Jahren zugenommen. Und ich sehe bei uns immer mehr Frauen, die auch Oberärztin werden, in höhere Positionen kommen. Und sehe für mich, da hab ich da nie ein Problem gesehen. Also ich hab dann nicht so drüber nachgedacht, ob ich jetzt weniger Schlagkraft habe als ein Mann. Natürlich hab ich in dem Bereich, auch im autonomen Nervensystem, mit vielen erfahrenen Männern zu tun gehabt. Und sicherlich muss man sich dann erst mal eine gewisse Position vielleicht auch verschaffen, ins Gespräch kommen, bei uns im Bereich dann halt auch forschen, publizieren. Ja, also das wird man sicher müssen, aber ich sehe das ja bei meinem Mann, der in einem anderen Bereich arbeitet, er muss das als Mann auch. Und ich bin da sehr neutral eingestellt, weil ich habe auch in meinem Leben nicht die negativen Erfahrungen gemacht. Ich weiß, dass das anders ist und ich weiß, dass das ein schwieriges Thema ist, aber ich kann aus meiner Perspektive sagen, ich habe Spaß daran an meinem Beruf, ich setze mich für die Patientinnen ein und versuche das, was geht. Ob ich jetzt das als Mann oder Frau mache, habe ich so nicht als Hindernis gesehen.
Sturm:
Das ist eine sehr diplomatische Antwort. Und was tust du, beziehungsweise auch was können andere Mediziner*innen tun, um gerade den Patienten, die so viele negative Erfahrungen gemacht haben, wieder das Vertrauen zurückzugeben in die Ärztinnen, die da vor Ihnen sitzen?
Maier:
Ja, also das Wichtigste ist wirklich, erstmal zuzuhören und ernst zu nehmen und das auch zu sagen, dass man die Beschwerden, die jemand hat, ernst nimmt und dass man auch den Leidensdruck verstehen kann, der da häufig hinter steckt und auch den Frust. Dann aber auch zu schauen, wie kann man jetzt konstruktiv in eine gewisse Richtung gehen. Mir steht ja auch nur begrenzte Zeit zur Verfügung. Das hört sich an, als hätten wir viel Zeit. Das ist ja nicht so. Ich hab vielleicht mehr Zeit als fünf oder vier Minuten beim Hausarzt. Aber ich hab auch nur begrenzte Zeit, wenn die Patientinnen bei mir sind. Ich muss schon als Ärztin das Gespräch führen. Ich muss gucken, wo brennt heute so richtig der Schuh. Ich muss das Ganze strukturieren. Das muss ich aber auch den Patientinnen kommunizieren, damit man die Zeit, die man gemeinsam hat, dann auch so effektiv nutzt, dass der Patient zumindest mit einer Sache, die man gemeinsam erarbeitet hat, auch nach Hause gehen kann. Das heißt, für mich ist die erste Frage, wie geht es? Was ist im Moment am schwierigsten? Und wo wünscht sich das Gegenüber gerade Unterstützung? Und dann muss ich mich fragen, kann ich das gerade leisten? Oder muss ich da an jemand anderes verweisen? Und gibt es einen anderen Aspekt, wo ich helfen kann? Aber auch klar zu sagen, wenn wirklich eine riesige Menge an Problemen da ist, dass man die jetzt auch wirklich strukturieren muss und auch mal systematisch angehen. Weil auch bei uns, bei mir im Alltag, die Zeit ist begrenzt. Und es ist natürlich so, dass man als Patient dann kommt und denkt so, jetzt lösen wir alle unsere Probleme. Aber das ist bei den chronischen Erkrankungen leider ja nicht möglich. Das heißt, man sollte oder die Kolleginnen, die Patientinnen mit chronischen Erkrankungen betreuen, und da habe ich ja auch viele… Ich glaube, die hören zu, die schauen, wo drückt der Schuh, und dann überlegen sie mit dem Patienten gemeinsam, wohin geht’s, und wo kann ich als Arzt dann helfen, wo ist meine Kompetenz gefragt? Mein Fachwissen, meine Therapieempfehlung, mein Rezept, was immer benötigt wird, und da zu unterstützen, wo es gerade für uns möglich ist. Und es gibt Ebenen, da können wir nicht helfen, oder unsere Disziplin nicht helfen. Und dann auch zu sagen, nee, da kann ich jetzt leider nicht helfen.
Sturm:
Wie ist das für dich, wenn ich jetzt quasi … Sagen wir mal, wir würden uns jetzt nicht kennen, ich wäre noch ganz in der Anfangsphase, hätte noch keine Diagnose und wäre noch gerade in dieser Phase, wo ich ständig irgendwie negative Erfahrungen mache und Fehldiagnosen sammle und ich komme zu dem Termin mit dir, erwarte im Endeffekt dasselbe, also dass du mir auch nichts glaubst. Wie kommt es bei dir rüber, wenn ich mit diesem angesammelten Frust vor dir sitze? Und wie könnten sich Patient*innen besser bei ersten Terminen mit neuen Ärzten verhalten?
Maier:
Also, ich sag bei mir im Alltag auch immer, man sagt ja immer, gib jedem Tag die Chance, dass er neu genutzt werden kann. Also, so ein bisschen, gib jedem Tag die Chance, der Schönste deines Lebens zu sein. Das ist ja sehr übertrieben. Aber ich geh auch im Alltag in Situationen wieder neu hinein. Und das ist natürlich ein Tipp, den zu geben, ist superschwer. Aber ich kann nur dazu raten, wenn man eine neue Situation gibt, sich zu setteln und an dem Moment neu anzufangen, zu sagen, das ist eine neue Chance, das ist ein neuer Arzt, eine andere Ärztin. Und ich gehe jetzt erst mal in den Termin, ich schildere meinen Grund, warum ich komme, ich habe meine Unterlagen dabei, sage vielleicht am Anfang, das ist schon gut, wenn man sagt, ich habe eine komplexe Erkrankung, aber ich erhoffe mir an der und der Stelle Hilfe und Unterstützung. Und dann zu beschreiben, was das Problem ist.
Sturm:
Mhm. Also, wenn ich jetzt noch mal von mir ausgehe, ich hab immer noch bei jedem Termin Angst vor irgendwelchen schlechten Erlebnissen. Aber mittlerweile, was ich für mich so entdeckt hab, was manchmal ganz gut funktioniert, ist, dass ich bei jedem neuen Termin dem Arzt oder der Ärztin direkt sag, dass ich eben diese Erfahrungen gemacht hab, was ich mir von der Person erhoffe beziehungsweise erwarte, und frage, wie ich dazu beitragen kann, irgendwie zu diesem Ziel zu kommen. Das funktioniert manchmal ganz gut, also vor allem gerade so mit Ärztinnen in meinem Alter. Die sind da, also arbeiten gern mit mir auf Augenhöhe, aber ich habe da auch schon das völlige Gegenteil gehabt, wo mein Gegenüber direkt gesagt hat, na ja, sie spinnen wohl ein bisschen. Sowas machen wir Ärzte nicht. Wie soll ich oder Patientinnen allgemein deiner Meinung nach an dich herantreten? Also was würdest du dir wünschen?
Maier:
Also, ich sehe ja, was im Alltag passiert. Und die meisten Patientinnen melden sich ja für einen Termin. Bei uns ist es so, dass ich weiß, warum die Patientinnen kommen, weil ich brauch im Vorhinein auch Befunde und Fragestellungen. Das Wichtigste für mich als Arzt ist ja zu wissen, was ist die Frage des Patienten oder was ist das Problem? Das heißt, was schon sehr hilfreich ist, ist, wenn man als Patient, gerade wenn es komplex ist, auf einer Seite kurz und knapp die Hauptsymptome zusammengefasst hat oder einfach mal sagt, ich gebe Ihnen das mal, können Sie später noch mal nachgucken. Das finde ich für mich persönlich superhilfreich. Ich finde es sehr hilfreich, wenn es einen kurzen Überblick über die Beschwerden gibt, vor allem, wenn alle Befunde dabei sind. Das ist mir persönlich am wichtigsten. Was ich nicht mag, ist, wenn ich nur die Hälfte der Befunde sehe und nicht weiß, was wurde gemacht, was nicht. Ich möchte auch keine Sachen doppelt machen, die Akten und Befunde mit dabei sind und am besten chronologisch geordnet, weil dann kann ich die einmal durchgucken und sehe, was wurde gemacht, wo stehen wir. Und das geht, wenn man geübt ist ja auch in einer gewissen Zeit, in der man sich einen Überblick verschaffen kann. Das ist das, würde ich sagen, was mir am meisten hilft. Was ich ganz schwierig finde, ist, wenn Patientinnen kommen und einfach sagen, es ist alles komplex, aber sie haben nichts dabei, weil dann ist für mich natürlich auch der Punkt, das erlebe ich auch, dass wenn jemand sagt, er möchte, dass sie sich selber einen Einblick machen, dann sage ich, das mache ich total. Ich verschaffe mir gerne einen Überblick. Ich untersuche, ich höre zu. Aber dann brauche ich auch die Vorbefunde.
Sturm:
Aber das machst du dann schon? Weil das zum Beispiel ist auch was, da glaube ich, ein Haufen andere Ärzte würden da sagen, nee, wenn das schon alles gemacht worden ist, wieso sollte ich mir da noch mal die Mühe machen?
Maier:
Nee, ich mache nur das, die Dinge noch mal, bei denen vielleicht Unklarheiten sind. Aber ich nehme ja auch nicht jedes Labor noch mal ab, sondern wenn ich weiß, das wurde schon gemacht und das ist jetzt vom Zeitraum her gerade in Ordnung, dann muss ich das ja nicht noch mal machen. Ich meine, wir sind ja auch in einem Gesundheitssystem, wo ja auch eine gewisse Wirtschaftlichkeit, muss man auch sagen, wichtig ist. Und dann habe ich doch lieber das Geld, um die komplexeren Diagnostiken zu machen und die Dinge, die schon dreimal gemacht wurden, natürlich dann nicht noch mal zu machen. Deswegen sind die Vorbefunde einfach wichtig. Aber das ist auch eine Art von mir. Ich gucke eigentlich nicht in die Vorbefunde, bevor der Patient zu mir kommt. Wenn ich Screening für die Ambulanzen mache, gucke ich da rein. Aber bis der Patient bei mir ist, habe ich das vergessen. Das heißt, was ich immer mache, auch auf der Station, ich höre mir als Erstes an, was sagt mir der Patient. Und dann gucke ich in die Vorbefunde, weil dann bin ich unvoreingenommen und kann mich drauf einlassen und kann mir erst mal meine eigene Verdachtsdiagnosen stellen. Und danach gucke ich mir den Rest an. Das erlebe ich auch immer mal wieder, dass Patientinnen sagen, aber ich habe ihnen doch alles geschickt. Und dann sage ich, ja, das weiß ich, das liegt auch hier, da kann ich reingucken, wenn ich reingucken möchte.
Sturm:
Aber die Sache, dass die dir keine Befunde geben, du weißt auch, wo die herkommen. Das sind dann wahrscheinlich nämlich alles Befunde, wo halt irgendwelche psychischen Fehldiagnosen drin stehen und die haben Angst, dass du im Endeffekt die einfach nur übernimmst und die wollen, dass du unvoreingenommen bist.
Maier:
Ja, aber psychiatrische Diagnosen sind ja nicht gleich Befunde. Das ist schon ein Unterschied. Und wenn ich Befunde sehe, also Untersuchungsbefunde, Magenspiegelung, Darmspiegelung, Kreislauftestung, da steht ja schwarz auf weiß, was erhoben wurde, wenn das richtig erhoben wurde. Die Diagnose, das ist ja noch mal klar, das ist das Ergebnis der Befunde. Bei den psychiatrischen Erkrankungen, ja, da ist das anders. Das kann ich verstehen, da sollte man vorsichtig sein. Aber für mich als Neurologe, ich stelle keine psychiatrischen Diagnosen, nicht mehr meine Aufgabe, sondern ich schaue mir die Vorbefunde an. Für mich ist wichtig, wurde ein Bild vom Kopf gemacht und da möchte ich auch gern das richtige MRT sehen und nicht nur den Befund, sondern die Rohdaten, weil nur so kann ich als Ärztin die korrekte Diagnose stellen oder auch mal sagen, nee, also die Diagnose ist so nicht korrekt.
Sturm:
Wir haben ja zusammen ein Buch geschrieben und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, wie arg sich unsere Perspektiven trotzdem manchmal unterscheiden. Also obwohl wir, es soll jetzt nicht so klingen, als hätten wir hier irgendwie gestritten oder so was, aber wir sind ja eigentlich immer relativ auf einer Wellenlänge, aber da gab es diese eine Situation, bei der ich was vorgeschlagen hatte und zwar, dass Patientinnen alle Befunde nur an sich selber schicken lassen sollen. Und das mache ich immer so, weil ich dadurch vermeiden kann, dass falsche Befunde beziehungsweise falsche Diagnosen einfach so von Arzt zu Arzt weitergereicht werden. Für mich persönlich macht es super viel Sinn. Du hattest allerdings angemerkt, dass du gar nicht zustimmst erstmal und dass dadurch Versorgungslücken entstehen und das eben nicht für jede oder jeden Patienten gut ist. Bis du mir das gesagt hattest, habe ich da nie einmal irgendwie darüber nachgedacht, weil das für mich ein Prinzip ist, dass es total gut funktioniert. Aber mir ist dann auch aufgefallen, dass es halt vielleicht einfach nicht für jeden Patienten, für jede Patientin so funktioniert und eigentlich ist es super offensichtlich und es war ein total wichtiger Denkanstoß für mich. Gleichzeitig habe ich dir aber erklärt, wo ich herkomme und dadurch hast du irgendwie auch wieder besser verstanden, die Patientinnenperspektive, die dir vielleicht manchmal auch fehlt. Aber die Art von super ehrlicher und offener Unterhaltung und Austausch, die wir da hatten während dem Buchschreiben, funktioniert halt nur, wenn da kein Machtgefälle ist zwischen Medizinerinnen und Patientinnen und man auf Augenhöhe miteinander kommuniziert und ein Grundvertrauen da ist, weil ansonsten traut man sich so ehrlich gar nicht sein. Und meine Frage an dich wäre, wie bekommen wir das hin, dass mehr solche Ärztinnen-Patientinnen-Teams wie wir beide existieren? Also wie kann das, ist das überhaupt realistisch in unserem Gesundheitssystem?
Maier:
Ja, vielleicht nochmal zurückkommen auch auf den Arztbrief. Das ist schon wichtig, finde ich, und das haben wir ja dann auch besprochen, dass man ja einerseits als Arzt derjenige ist, der dann die Diagnose stellt, der auch die Erfahrung hat und die Therapieempfehlungen gibt. Aber gerade im Bereich der seltenen Erkrankungen ist es ja so, dass nicht alle Patientinnen mit seltenen Erkrankungen in Deutschland in seltenen ZSEAs, also Zentren für seltene Erkrankungen oder Spezialambulanzen, behandelt werden können. Und mein Hauptanliegen, was ich so für mich im Leben, für die nächsten Jahre irgendwie richtig toll finde, wäre, wenn es funktioniert, dass das Wissen, was wir an den ZSEAs haben, das wir bei uns in den Spezialambulanzen haben, auch in die Peripherie getragen wird. Und das ist mein Anspruch, warum geht jeder Brief an den Hausarzt? Weil selbst, wenn nicht jeder Brief gelesen wird vom Hausarzt, weil vielleicht einfach die Zeit fehlt, es gibt Ärztinnen und Kollegen, die sich sehr, sehr für die Patientin einsetzen, die richtig froh sind, wenn Sie auch noch mal einen Brief bekommen von einem Kollegen, der vielleicht in dem oder dem Bereich Empfehlungen geben kann. Und so können wir Wissen weitergeben. Wir können es an unsere Kolleginnen weitergeben, wir können Links zu bestimmten Seiten in den Brief schicken. Das ist für mich der Grund, warum jeder Brief an den Arzt geht. Und natürlich auch an den Patienten. Es muss einem auch bewusst sein, wir schreiben ja im deutschen Gesundheitssystem keine Briefe, die in einfacher, verständlicher Sprache für Patientinnen geschrieben sind. Der Arztbrief hat bei uns erst mal die Bedeutung, den Fachkollegen zu informieren, damit die Weiterbehandlung der Patientinnen gesichert ist. Das ist so der aktuelle Standard, so wie ich das gelernt habe im Studium. Warum schreibe ich einen Arztbrief? Darüber lässt sich sicherlich diskutieren, ob man das in Zukunft noch so möchte. Aber der Brief ist eine Information, ein Wissenstransfer von A nach B. Und eigentlich ist der Brief sehr wichtig. Jetzt gibt es Länder, da haben wir eine Gesundheitsversorgung, wo alles digitalisiert läuft. In den kommunalischen Ländern, da kann man als Patient in seine eigene Akte reingucken, man sieht, welche Notizen der Arzt gemacht hat. Das heißt, das ist alles ganz transparent. So kann der Kollege direkt wissen, was hat der andere Kollege gemacht, der kann direkt sehen, was empfiehlt der Kollege. Aber auch als Patient bin ich mit involviert. Und das ist für mich eine Art, wo man sagt, man behandelt den Patienten auf Augenhöhe, man ist mit den Kollegen auf gleicher Augenhöhe, man gibt sich Empfehlungen untereinander in den Arztbriefen beispielsweise, man greift vielleicht auch mal zum Hörer, wenn irgendwas unklar ist. Und ja, ich glaube nur durch so eine offene Kommunikationsstruktur kann man das auch in Zukunft schaffen. Und ich sehe natürlich auch die Generationenveränderungen. Ich sage mal, vor 20 Jahren wäre das wahrscheinlich sehr, sehr untypisch. Es wäre so untypisch, wie es heutzutage in den Praxen ist, in den Teams, dass man sich auch zwischen den Ärzten untereinander oder verschiedener Ausbildungswege auf Augenhöhe begegnet. Aber das sehe ich in unserer Generation und der, der danach kommt, immer mehr. Und ich glaube, das ist der Weg, der uns in die richtige Richtung führt, sofern das alles machbar ist. Also ein Arzt- und Patientenverhältnis muss es geben. Das muss fachlich sein, das muss eine gewisse Distanz auch haben. Und dazu führen, dass der Patient so behandelt wird, wie es der aktuelle medizinische Standard erlaubt und vorgibt.
Sturm:
Jetzt bist du ja auch super, super engagiert. Haben wir ja vorher schon mal kurz angesprochen. Du bist im Fachbeirat von der Ehlers-Danlos-Initiative. Du bist im POTS-Verein. Wie schaffst du das alles bzw. wie kannst du überhaupt privat und beruflich trennen? Weil ich gehe davon aus, du triffst dann ja auch super viele Patientinnen und vielleicht schreiben die dir private Mails. Wie gehst du damit um?
Maier:
Also ich trenne schon Arbeit und Beruf. Ich habe meine Arbeit, wo ich unter der Woche die Patientinnen sehe. Da habe ich meine Kollegen. Alles, was mit Patientinnen zu tun hat, geht professionell über diese Ebene. Im Privaten gebe ich keine medizinischen Tipps und nehme auch keinen privaten Nachrichten, E-Mails, sonstiges entgegen, was mit der Arbeit zu tun hat. Das muss ich trennen. Ich brauche die Energie. Wenn ich morgens zur Arbeit gehe, brauche ich die Energie, um die dann vor Ort den Patientinnen zu geben, die dort vor Ort sind. Und wenn ich nach Hause komme, dann brauche ich Energie für meine Familie, für die Regeneration und vielleicht auch mal am Wochenende oder abends für die Meetings, die dann im Rahmen der Selbsthilfe anstehen. Aber das trenne ich schon. Das muss ich auch trennen, weil ich muss auch schauen, dass ich selber gesund bin, dass ich selber Energie habe. Und die habe ich nicht, wenn ich ständig in Kontakt bin mit Patienten, mit Kollegen und nicht auch in meinem privaten Raum abschalten kann. Klar, natürlich verschwimmen manche Dinge. Gerade in der Forschung geht natürlich vieles auch mit ins Privatleben. Aber das sind so Dinge, die mir Spaß machen, wo ich aber dann auch mal sagen muss, jetzt bin ich im Urlaub, und jetzt wird mal das Handy ausgemacht. Ich glaube, das ist so eine gesunde Psychohygiene, die man in anderen Berufen auch hat. Oder haben sollte oder erlernen kann. Ähm, genau. Also ich bin privat mit meinen Patientinnen nicht in stetigem Kontakt, sondern ich sehe die Patientinnen, wenn sie zu uns kommen in die Klinik und dort, wenn sie vor mir sitzen, geht die Behandlung los. Aber ich kann nicht rund um die Uhr und für jeden Anruf und jede E-Mail zur Verfügung stehen. Und das ist auch wichtig. Und dann kann man nämlich die Patienten, kann ich, also vielleicht kann das jemand anders, aber ich kann dann diejenigen, die vor mir sitzen, nicht richtig versorgen und die Sachen nicht abschließen. Da bin ich, glaube ich, recht strukturiert.
Sturm:
Das ist gut. Das heißt, du brennst uns nicht aus. Weil so geht es ja irgendwie relativ trotzdem vielen Ärztinnen, die so engagiert sind.
Maier:
Ja, das hoffe ich. Also natürlich muss ich da auch lernen und auch meine Grenzen finden. Aber das ist schon für mich ein wichtiges Motto, dass ich die Arbeit nicht komplett mit nach Hause nehme und dann am Wochenende auch noch, ja, E-Mail schreibe oder überhaupt per E-Mail da mit Patientinnen kommuniziere. Das geht ja schon allein aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht. Und das mache ich auch nicht.
Sturm:
Wie können denn wir Patientinnen unsere Ärztinnen besser schützen? Also, dass die nicht super überfordert sind und wir die nicht auch noch privat rein stressen?
Maier:
Ich glaube, erst mal ist jeder dafür selber verantwortlich, sich privat zu schützen. Das heißt, das ist nicht Aufgabe von einem Patientin oder Patientin, die Ärzte zu schützen, sondern man muss da als Ärztin auch dann seine Grenzen kennen und setzen. Und die sind bei jedem anders. Das heißt, so ein Patentrezept gibt es da nicht. Was ich schon zunehmend sehe, ist, dass, wenn sich Ärztinnen kümmern, dass dann tatsächlich ständig die Mailfachs voll sind. Und da frage ich mich dann, muss das sein? Das mache ich auch nicht. Ich schreibe auch in meinem Haushalt keine E-Mails. Ja, das ist aber auch dann Aufgabe der Ärztin, auch zu sagen oder zu kommunizieren, es geht nicht. Und als Patient vielleicht auch zu überlegen, wenn ich Fragen habe, wenn ich einen Arzttermin habe, dann sammle ich im Vorhinein meine Fragen. Dann schreibe ich mir die auf. Wenn man aufgeregt ist im Arzttermin, dann vergisst man ja was, dann hat man lieber einen Zettel. Aber man kann nicht erwarten, dass Ärztinnen, vor allem die, die sich einsetzen, ständig rund um die Uhr erreichbar sind. Und auch nicht während der Arbeitszeiten. Ich glaube, das ist ein Aspekt, das sage ich auch gern mal in der Runde. Weil das können wir gar nicht leisten. Ich bin von der Art her ein Mensch, wenn ich etwas mache, dann bin ich dem Gegenüber… Versuche ich eigentlich, da zu sein, im Hier und Jetzt, und wenn ich den Arztbrief schreibe, das Ganze noch mal zu durchdenken. Aber ich kann nicht dazwischen auch noch immer ständig für alle Fragen bereitstehen. Und das geht auch nicht. Das wird nicht funktionieren.
Sturm:
Aber was kann ich denn jetzt als Patientin überhaupt von meinen Ärztinnen erwarten?
Maier:
Also ich denke, was man erwarten kann, ist, dass jemand vor einem sitzt, der nicht ohne Grund Ärztin geworden ist, der studiert hat, der sich mit einem Thema beschäftigt hat, der gewisse Interessen auch hat, die ihn besonders interessieren, weil er sich für eine Facharztausbildung beworben und eingesetzt hat. Und ein großes Fachwissen hat, das er eigentlich mit seinen Patienten ja auch teilt. Beziehungsweise versucht, genau dieses Wissen anzuwenden, um dem Patienten zu helfen. Das kann man vom Arzt erwarten, dass der, der da sitzt, mit seiner Fachbezeichnung diese Voraussetzung erfüllt. Sonst wäre er kein Arzt geworden. Und dann zu schildern, was sind die Beschwerden, und dass der Arzt die Ärztin die Diagnose stellt und eine Therapie bespricht. Ich wünsche mir, dass meine Kollegen auch alle weitermachen und dass auch politisch gesehen der Arztberuf und vor allem auch der Pflegeberuf die Anerkennung hat und bekommt, die er verdient und auch die finanziellen Mittel, damit die Patientinnen gut versorgt werden. Das ist ein großer Wunsch, aber das wäre mein Wunsch.
Sturm:
Dem kann ich mich einfach nur so anschließen, da gewinnen am Ende nämlich Patientinnen und Medizinerinnen zugleich.
Maier:
Genau.
Sturm:
Liebe Andrea,
ich danke dir, dass du heute da warst und dir so viel Zeit für mich genommen hast und ich hoffe, dass unser Austausch hier vielleicht ein paar gute Anregungen für unsere Zuhörerinnen hat.
Maier:
Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich.
Outro:
Wenn ihr mehr wissen wollt, über die Erkrankungen, die wir im Podcast nur kurz angesprochen hatten, aber nicht im Detail erläutert haben, dann schaut doch mal auf meiner Website vorbei: www.karina-sturm.com.
Und das wars auch schon wieder, mit einer weiteren Episode von Aches, Pains und Smiles. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört! Bye!
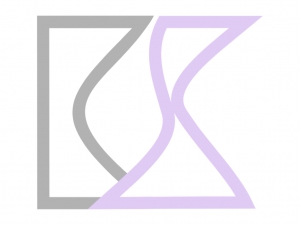



 Karina Sturm
Karina Sturm  Karina Sturm
Karina Sturm 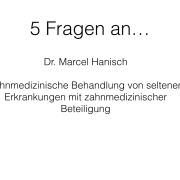 Karina Sturm
Karina Sturm 

 Karina Sturm
Karina Sturm 


Was für eine großartige Ärztin! Danke auch dir, Karina, für dieses Interview. Es macht deutlich, wie wichtig auch im Arzt-Patientenverhältnis Beziehungsarbeit und respektvolle Kommunikation auf Augenhöhe ist. Wir sollten als Patienten und Ärzte partnerschaftlich im gemeinsamen Interesse an der Gesundheit zusammenarbeiten. Dazu gehört dann auch, dass wir als Patienten Verantwortung übernehmen und z.B. die begrenzte ärztliche Zeit respektieren und so gut vorbereitet wie möglich in einen Termin gehen. Die oft leider übliche, scheinbar willkürliche Vergabe von Psychodiagnosen ist ja offensichtlich ein flächendeckendes Problem besonders für Frauen, besonders bei chronischen Krankheiten…. Bin froh, dass es hier mal so deutlich mit seinen Konsequenzen angesprochen wird. Wenn Menschen sich dann psychotherapeutische Hilfe suchen um mit diesen jahrelangen Erfahrungen und den Folgen der chronischen Krankheiten besser klar zu kommen, wird dies leider ebenfalls genutzt, um zu psychiatrisieren, was dann weitere somatische Diagnostik oder Behandlung verhindert. Deshalb werde ich mich persönlich trotz Systemerkrankung gegen die gläserne Patientenakte entscheiden.
Hallo Polly,
Danke Dir für diesen wunderbaren Kommentar. Ich versuche in letzter Zeit viel über Gender Bias und Gaslighting zu sprechen, weil das in Deutschland noch nicht so richtig angekommen ist, obwohl wir das ständig erfahren… Ich würde mich zu jedem Zeitpunkt gegen die Weitergabe meiner medizinischen Befunde entscheiden, denn da werden ständig nur Fehldiagnosen weitergegeben, was letztlich echt großen Schaden macht.
Gruß,
Karina