Die „der-Arzt-hat-immer-Recht“-Kultur
von Karina Sturm.
Die Tür schwingt auf. Schnellen Schrittes nähert sich ein Mensch in weißem Kittel, ein Stethoskop um den Hals, die Brille etwas nach unten gerutscht. Eine respekteinflößende Gestalt schaut mich von oben herab an. Manchmal mit lächelnder Miene, manchmal ernst, arrogant oder überheblich. Doch egal welches Gesicht, auch wenn es mir noch so nett entgegenblickt, ich werde nervös.
Ärzte haben immer Recht.
Bedenkt man, dass Termine bei Ärzten, Krankenkassen, Behörden und ähnlichem für mich praktisch seit sechs Jahren zum Alltag gehören, zeigt dies nur, wie tief die Ehrfurcht vor Ärzten sitzt. Und obwohl mein Umfeld mich eigentlich nie in diese Richtung gedrängt hat, bin ich doch mit dem Gedanken aufgewachsen, dass Ärzte immer Recht haben und immer wissen was sie tun.
Oder nicht?
Man kann sich kaum vorstellen welch ein erschütterndes Erlebnis dann der erste Tag meiner Erkrankung war. Im August 2010 fing dieses Bild langsam an zu bröckeln. Doch auch nach den ersten negativen Erfahrungen mit Ärzten hatte ich immer noch den Eindruck, ich müsste mich unterordnen; alles tun was mir gesagt würde, um wieder gesund zu werden. Es dauerte sehr lange bis ich realisierte, dass es besser war, wenn ich mich um meine Gesundheit selbst kümmerte. Ich glaube, diese Einsicht kam mit der ersten F-Diagnose. Irgendwann war die Glaubwürdigkeit der damaligen Ärzte nicht mehr gegeben.
Angst vor Ärzten
Und trotz all der Jahre und vermutlich um die 200 Ärzte, die ich seither gesehen habe, bin ich trotzdem nach wie vor nervös sobald ich nur einen Fuß in ein Wartezimmer setze.
Woran liegt das?
Einmal daran, dass Ärzte, auch wenn sie mir nicht mehr direkt schaden können, immer noch großen Einfluss auf mein Leben, aber vor allem auf meine finanzielle Zukunft, haben können. Als chronisch Kranker kommt man nicht drum herum Termine bei Spezialisten wahrzunehmen und jeder, der einmal Rente beantragt hat oder ähnliche Leistungen bekommt, weiß, ohne gute Befunde von Ärzten, die wissen was sie tun, kommt man nicht weit.
Im Gegenschluss bedeutet das aber auch, dass Ärzte, die eben nicht spezialisiert auf dem Gebiet meiner Erkrankungen, dem Ehlers-Danlos-Syndrom, sind, großen Schaden anrichten, indem sie falsche Einschätzungen abgeben, z. B. bei Gutachten, die dann gegen mich verwendet werden können. Als arbeitsunfähiger, kranker Mensch muss man unglaublich viele kleine Faktoren beachten und traurigerweise sind das alles Erfahrungen, die man meist erst versteht, wenn sie bereits nach hinten losgingen. Diese Lernkurve hätte ich mir sehr gerne dadurch erspart, dass mich jemand vorgewarnt hätte.
Manche Ärzte haben auch Angst vor mir.
Natürlich setzt diese große Verantwortung über ein komplettes Leben, mein Leben, die Ärzte unter Druck und viele schrecken dann lieber ganz zurück. Gerade möglicher Ärger mit sozialen Trägern wirkt nicht unbedingt anziehend auf Ärzte. Letztlich geht es um viel Arbeit für praktisch kein Geld. Und was bleibt uns Patienten dann übrig? Bitten und betteln. Eine Disziplin, die ich nicht besonders gut beherrsche. Widerstrebt es mir doch sehr, um etwas zu betteln, was uns Patienten eigentlich zustehen sollte.
Fehldiagnosen haben schwere Konsequenzen.
Neben den möglichen Einflüssen ärztlicher Befundberichte auf sozialrechtliche Streitigkeiten, können sich negative Befunde auch schlecht auf das ganze ärztliche Unterstützungsnetzwerk auswirken. Tanzt nur einer der Ärzte aus der Reihe und zweifelt eine bereits umstrittene Diagnose weiter an, oder äußert gar eine psychische Verdachtsdiagnose, verbreitet sich diese wie ein Lauffeuer und fackelt jede kleine Hoffnung, die sich auf dem Weg findet, konsequent ab.
Diese Befunde sind häufig wie Mitesser, drückt man einen aus, taucht er an anderer Stelle wieder auf.
Immer schneller verbreitet sich die potenzielle Fehldiagnose und am Ende kann es gut sein, dass unser komplettes Team voreingenommen von nur einer einzigen Meinung eines Kollegen ist. Schon reißt es ein großes Loch in das fragilen Netzwerk von Ärzten und wenn alles schief geht (was meistens der Fall ist, denn eine Niederlage kommt selten allein), stehen wir am Ende wieder bei Null und müssen ganz von Neuem beginnen. Und für alle, die sich nun fragen, wo denn genau das Problem ist, es gibt doch schließlich genug Ärzte, oder? Nein, leider ist es außerordentlich schwierig unter dem großen Angebot an Ärzten, den kleinen Teil herauszufiltern, der überhaupt gewillt ist Teil des „Team Karina“ sein zu wollen. Es bedarf jahrelanger Arbeit ein im Ansatz funktionierendes Netzwerk aufzubauen und ist mit vielen Rückschlägen, Enttäuschungen und Energie verbunden. Daher ist der Verlust dieser Unterstützung, eine der schlimmsten Dinge, die jemandem wie mir passieren kann.
Wir sind abhängig von unseren Ärzten.
Blicke ich nun zurück auf mein gerade Geschriebenes, wird mir wieder klar, weshalb eine gewisse Ehrfurcht nie vergehen wird. Wir sind eben bis zu einem Grad von unseren Ärzten abhängig und das ist ein sehr erschreckendes Gefühl. Ist es doch nicht so, als könnte man sich seine Ärzte immer aussuchen oder gar jede erdenkliche Situation durchplanen. Es gibt immer Variablen und wir leben mit der ständigen Angst am Ende als Verlierer aus der Nummer rauszugehen.
Interessanterweise geht es, was die Haltung gegenüber Ärzten angeht, auch gesunden Menschen ähnlich. Es scheint eine Art Grundrespekt vor dem Beruf des Arztes zu geben und ein tiefes Vertrauen in deren Arbeit. Zumindest bis zur ersten oder zweiten Negativerfahrung.
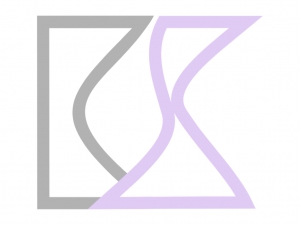
 Karina Sturm
Karina Sturm  Katrin Pagel
Katrin Pagel





 Jetzt.de
Jetzt.de
 Karina Sturm
Karina Sturm 
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!