Warum ich als chronisch kranke Person heute eine andere Meinung zu Therapie habe
Noch vor zwei Jahren hätte ich nie auch nur darüber nachgedacht, eine Therapie zu beginnen. Tja, Dinge ändern sich und scheinbar kann sogar mein stures Ich ihre Meinung ändern und dazulernen. Obwohl mein Verhältnis zu Therapie bis heute eher eine Hassliebe geblieben ist, hat sie mein Leben zum Besseren verändert. Mittlerweile sehe ich meine Therapeutin nicht nur, wenn ich mich unwohl fühle, sondern wir treffen uns regelmäßig, um einfach nur zu quatschen. Ich habe erkannt, dass Therapie nicht nur für Menschen in akuten Notsituation da ist, sondern dass sie generell für jeden hilfreich ist. Hier ist weshalb.
“Häh? Du hast keinen Therapeuten? Wieso das denn?”
Kurz nachdem ich nach San Francisco gezogen bin, lernte ich einige super liebe Menschen aus der LGBTQ-Community kennen und in einem der ersten Gespräche mit meinen neuen Freunden ging es um Therapie. Ich stand gerade vor einer eher kleinen Herausforderung – als chronisch Kranke war ich es gewohnt ständig mit Problemen konfrontiert zu sein; das war also nichts Neues oder Besonderes für mich – und erzählte den beiden davon. Ich versuchte zu erklären, dass mein Leben im Prinzip eine wiederkehrende Abfolge von ‘Shit Happens’ war und dass ich generell all diese Probleme mit mir selbst ausmachte. Für meine neuen amerikanischen Freunde war es ein Rätsel, dass ich keine professionelle Unterstützung in Anspruch nehmen würde. Schließlich sind Therapeuten doch genau dafür da, oder? Ähnliche Aussagen hörte ich von meiner neuen Hausärztin und vielen anderen Menschen in meinem Umfeld. Die meisten von ihnen besuchten einen Therapeuten einfach nur um zu reden. Ihr Therapeut war eine Art ‘Life Coach,’ der dabei half, positive Entscheidungen zu treffen und Probleme erst gar nicht aufkommen zu lassen. Für meine Freunde war ein Therapeut offenbar dazu da, Krisen zu vermeiden. Ein interessanter Ansatz, über den ich vorher nie nachgedacht hatte. Macht schon Sinn, oder?
“Hast du eine akute Krise?”
Meine Familie hingegen war nicht unbedingt auf der selben Wellenlänge. Die erste Frage, die meine Mutter mir stellte, als ich ihr sagte, dass ich eine Therapeutin habe, die mir sehr hilft, war: “Hast du eine akute Krise?” Nein, hatte ich nicht. Wie kam sie darauf? Anstatt glücklich darüber zu sein, dass ich mich um meine mentale Gesundheit kümmerte, eben genau um einen totalen Zusammenbruch zu vermeiden, machte sie sich Sorgen. In ihrer Welt – und ich habe viele Menschen getroffen, die genauso denken – sieht man einen Therapeuten nur dann, wenn etwas ernsthaft mit einem nicht stimmt. Besonders in der deutschen Kultur habe ich die Erfahrung gemacht, dass Menschen ihre Probleme nicht gerne mit anderen teilen. Sie bitten nicht um Unterstützung. Sie machen alles mit sich selbst aus. Um Hilfe zu bitten, wird als “Schwäche” angesehen. Außerdem sind psychische Erkrankungen in vielen Ländern immer noch stark stigmatisiert.
Chronische körperliche Krankheit und mentale Gesundheit
Zusätzlich zum fehlenden Verständnis der Öffentlichkeit in Bezug auf psychische Erkrankungen hatte ich meine ganz eigene tiefe Abneigung gegenüber Therapie. Der Grund dafür ist, dass ich unzählige Fehldiagnosen erhielt, bis endlich das Ehlers-Danlos-Syndrom festgestellt wurde. Von diesen Fehldiagnosen waren sicher 99 Prozent nicht vorliegende psychische Erkrankungen. Warum? Wie die meisten Menschen mit einer seltenen körperlichen Erkrankung (insbesondere die, die in Ländern wie Deutschland leben) wissen, bekommt man von Ärzten, die nicht innerhalb von fünf Minuten eine plausible Diagnose für die körperlichen Beschwerden finden können, schnell eine psychische Diagnose aufgedrückt und wird mit Antidepressiva nach Hause geschickt. An der Stelle hört es aber nicht auf. Jedes Mal, wenn man danach einen neuen Arzt aufsucht, wird immer wieder automatisch auf die psychische Fehldiagnose zurückgegriffen und damit die körperlichen Symptome nicht mehr ernst genommen. Und das ist nicht überdramatisiert. Mir ist das über viele Jahre so ergangen, was zu einem schweren Trauma geführt hat. Ironischerweise haben diese durch Ärzte ausgelösten Traumata letztlich zu einem PTBS geführt, an dem ich gerade in der Therapie arbeite. Aufgrund dieser Erfahrungen habe ich lange Zeit gar nicht zugeben wollen, dass ich es mit Angst und PTBS zu tun habe, weil ich immer die Sorge im Hinterkopf hatte, dass ich in eine Zeit zurückgeschickt werde, in der meine körperlichen Symptome wieder nicht ernst genommen werden – und das kann nach wie vor passieren, obwohl ich seit Jahren unzählige körperliche Diagnosen habe. Meine amerikanische Hausärztin versteht, dass meine Psyche nicht die Ursache meiner Bindegewebserkrankung ist. Wir werden sehen ob selbiges auch in Deutschland zutrifft…
2020 habe ich mit meiner Therapie begonnen.
Und meine Therapeutin tut mir bis heute noch leid. Ich habe sie quasi mit den angehäuften Traumata des letzten Jahrzehnts beworfen. Den größten Teil meiner Traumata hatte ich sicher verstaut. Generell habe ich eigentlich immer alles nur unterdrückt, weil ich nicht die Energie hatte, mich tatsächlich mit all den negativen Erfahrungen auseinanderzusetzen. Besonders in der Zeit, in der ich auf der Suche nach der Diagnose war, hatte ich so gar keine mentale Bandbreite, um diese vielen großen und kleinen medizinischen Traumata zu verdauen – vom beinahe Sterben wegen einer falschen Behandlung bis hin zu Gaslighting durch die Ärzte. Damals war ich im Kampf- und Überlebensmodus. Ich war darauf konzentriert, Antworten zu finden und schob einfach alles andere beiseite.
Ein Haus mit tausend Zimmern.
Meine neueste Lieblingsmetapher ist, dass meine mentale Gesundheit ‘ein Haus mit tausend Zimmern’ ist. Hinter einigen der Räume verbergen sich allerdings noch weitere versteckte Zimmer. In der Therapie öffne ich jeweils eine einzelne Tür. Manchmal weiß ich, was im Raum dahinter wartet, manchmal nicht. Manchmal ist da ein großes Chaos, für das ich Monate brauche, um es zu bewältigen. Manchmal, wenn ich den ganzen Müll in einem Raum beiseite geräumt habe, erscheint eine versteckte Tür, die zu einem viel tiefer liegenden Problem führt, das durch das ganze Chaos versteckt blieb.
Ich arbeite mich langsam durch das Chaos.
Zum ersten Mal räume ich auf. Langsam, aber stetig bewege ich mich durch alle Räume und verarbeite all das Trauma und all die anderen Probleme, die ich jahrelang von mir weggeschoben hatte. Ich dachte immer, ich hätte alles verdaut, während ich in Realität all meine Probleme hinter verschlossenen Türen versteckt habe. Meine Therapeutin nennt das ‘Kompartmentalisierung’. Während ich in der Vergangenheit viele meiner alten Traumata einfach verdrängt habe, arbeite ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal an ALLEM. In den ersten Wochen war das super schwierig, aber als ich dann die größten Probleme überwunden hatte, wurde es einfacher. Mittlerweile kontaktiere ich meine Therapeutin regelmäßig, um Probleme genau dann zu bewältigen, wenn sie auftreten, und sie nicht mehr zu unterdrücken, wie ich es gewohnt war.
Warum habe ich nun meine Meinung zu Therapie geändert?
Offensichtlich einmal, weil ich mich immer viel besser fühle, wenn ich mit meiner Therapeutin gesprochen habe. Sie hat mir geholfen, die stabilste und fokussierteste Version von mir zu werden, die ich seit langer Zeit nicht mehr war. Ich kenne und verstehe mich heute mehr denn je. Zusätzlich hat sie mich dabei unterstütz meine Angst- und Stresslevel deutlich zu reduzieren und generell fühle ich mich einfach glücklicher. Das hätte ich viel früher haben können, hätte ich mich mal mit all diesen Traumata befasst. Dadurch hätte ich mir viel harte Arbeit und unnötiges Leid erspart. Aber hey, besser spät als nie, oder?
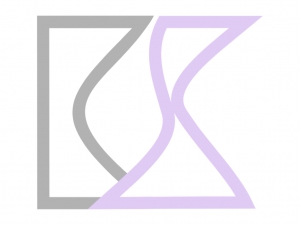


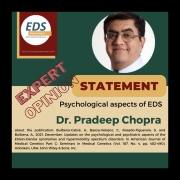


 Karina Sturm
Karina Sturm  Karina Sturm
Karina Sturm 




Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!