Von einem Extrem ins andere – Wie es sich anfühlt, bipolar zu sein, Teil 2
Dieser Beitrag ist Teil 2 einer Blogpostreihe der Bloggerin Lisa Waldherr. Lisa erzählt euch vom Beginn ihrer bipolaren Erkrankung und all den damit verbundenen Gefühlen. In Teil 1 könnt ihr erfahren, wie Lisas Leben während einer längeren Hochphase war. Im heutigen Teil 2 hingegen, beschreibt Lisa die Zeit in der sie das Hoch verlässt und ihr erstes großes Tief erlebt.
Und nun liege ich hier. Ganz alleine. Und so unfassbar traurig.
Verzweifelt. Ohne jegliche Hoffnung, dass dieser Zustand jemals vorbeigeht. Ich bin mutterseelenallein am anderen Ende der Welt. Keiner, der mir helfen kann. Keiner, der mir jemals helfen können wird. Während eine immer größer werdende bleierne Schwere meinen Körper bis zur absoluten Erstarrung lähmt, scheint mein Herz unter dieser Last erdrückt zu werden und pocht und rast panisch um sein Leben. Ich frage mich, ob so ein Herz einfach so stehen bleiben kann. Weil es nicht mehr möchte. Weil die Last zu schwer wiegt. Weil die finsteren und vernichtenden Gedankenspiralen in meinem Kopf es umwickeln wie Stacheldraht und immer fester zudrücken. Bis es aufhört zu schlagen. Einfach so.
Ich muss pinkeln.
Komisch, denke ich. Denn ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal etwas getrunken habe. Ich kann nicht aufstehen. Ich spüre etwas vibrieren. Es muss wohl mein Handy sein unter meinem Kopfkissen. Die Vibration überträgt sich direkt in mein Gehirn. Ich wünsche mir so sehr, dass es meine Gedanken einfach wegvibriert. Ich kann sie nicht stoppen. Sie werden immer finsterer und düsterer. Ich kann nichts gegen sie tun, ich habe nicht die Kraft dazu. Sie ergreifen Besitz von meinem Geist, der schließlich zur unumstößlichen Gewissheit kommt, dass alles absolut hoffnungslos ist und auch immer so bleiben wird. Dass sich niemals wieder etwas daran ändern wird. Dass ich komplett machtlos bin. In einer Welt, in der ich keinen Platz mehr habe.
Das Vibrieren hat aufgehört. Die Gedanken nicht.
Ein paar Minuten oder vielleicht auch Stunden später fängt das Handy erneut an zu vibrieren. Ich habe das Gefühl für Raum und Zeit verloren. Da, wo normalerweise vermutlich mal so etwas wie positive Empfindungen wären, ist Leere und Nichts. Was ist schon normal. Wahrscheinlich ist es Mama. Oder Papa. Die spüren das.
Fast pinkle ich ins Bett.
Doch mein Körper erweist mir den ersten und einzigen Dienst des Tages und steht irgendwie auf. Ich sehe mich wie aus einer Vogelperspektive und in Zeitlupe zum Klo gehen. An der Rezeption vorbei. „What’s up?“, meine ich aus weiter Ferne zu hören. Worte, die an der Blase, die sich um mich herum gebildet hat, abfedern und weiterhüpfen wie ein Flummi. Ich hebe nicht den Kopf, sondern gehe weiter Richtung Toiletten. Mein Körper setzt einen Fuß vor den anderen. Wie er das wohl macht, frage ich mich. Wie all die Körper auf dieser Welt all diese anstrengenden Schritte tun. Stunde um Stunde. Tag für Tag. Jahr für Jahr. Ein Leben lang. Unvorstellbar. Als ich die leeren Waschräume betrete, schaffe ich es nicht einmal zur Toilettentür und übergebe mich direkt in das Waschbecken links neben mir. Da ich nichts gegessen habe, färbt sich das Schneeweiß vor mir sonderbar grün, meine Speiseröhre brennt, als würde Säure in ihr hochsprudeln.
Und dann würge ich nur noch.
Möchte all den Schmerz, all die Traurigkeit, all die Angst und Hoffnungslosigkeit herauswürgen. Aber alles bleibt erbarmungslos in mir. Ich blicke in den Spiegel. Hätte ich die Kraft dazu, würde ich mich erschrecken. Aber auch das ist mir egal. Meine ungewaschenen Haare kleben verschwitzt an meiner Stirn. Ich bin bleicher als das Waschbecken vor mir, meine Lippen platzen an einigen Stellen auf. Über finsteren Augenringen liegen Augen in tiefen Höhlen und starren mich blicklos und leer an. Ich kenne diese Augen nicht. Aus ihnen ist jede Lebendigkeit und jeder Glanz gewichen. Lebendigkeit, die vor nur kurzer Zeit noch so überwältigend war, das ich nicht wusste, wohin mit meiner übersprudelnden Freude, Euphorie und Liebe. Lebendigkeit, an die ich mich schon jetzt nicht einmal annähernd mehr erinnern kann. Die soweit weg ist, das ich sie nicht greifen kann. Vielleicht hat sie auch nie existiert.
Ich habe es irgendwie zurück ins Bett geschafft.
Ich bin so erschöpft, dass ich am liebsten sofort schlafen würde. Einfach nur schlafen. Vergessen. Aber mein Körper hat keine Gnade, kein Erbarmen und lässt mir schon seit Tagen keinen Moment des Wegdriftens. Die einzige Zeit, die eine kurze Erholung von dieser unendlichen Qual gewähren könnte. Ich fühle mich, als würde ich sterben wollen. Ich will nicht sterben wollen. Ich möchte nur nach dem nächsten Schlaf am nächsten Morgen nicht aufwachen müssen. Für eine lange Zeit. Wie ein Winterschlaf.
Mein Flug nach Hause geht in zwei Tagen.
Ich habe keine Ahnung, wie ich all die Impulse an meinen Körper senden soll, damit dieser noch einmal funktioniert. Die notwendig wären, um mit all meinen Sachen all die Kilometer zu diesem Flughafen zu fahren und irgendwie in Deutschland zu landen, Warum überhaupt nach Deutschland? Studium. Auch das könnte mir nicht gleichgültiger sein. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich mich eigentlich einmal darauf gefreut hatte und immer wusste, dass ich genau das in genau dieser Stadt studieren wollte. Bis vor zwei Wochen vermutlich.
„Miss? Miss! Phone! For you. Dad!“
Neben mir steht die Rezeptionistin und streckt mir einen Telefonhörer entgegen. Sie hat knallrote Haare. War mir vorhin gar nicht aufgefallen. Kann man eigentlich nicht übersehen. Ich greife wie in Zeitlupe nach dem Hörer. Halte ihn an mein Ohr. Und höre die Stimme meines Vaters. Diesen Tonfall kenne ich nicht von ihm. Er macht mir Angst. Ich frage mich noch, wie er es ohne jegliche Englischkenntnisse wohl geschafft hat, dem Mädel von der Rezeption beizubringen, wer er ist und was er möchte. Vielleicht hatte Mama ihm das aufgeschrieben. Egal. Das, was in den nächsten Minuten zwischen uns stattfindet, kann man nicht als Gespräch bezeichnen.
Abwechselnd reden meine Eltern mich ein.
Dann weint Mama und Papa nimmt den Hörer wieder an sich. Mama schluchzt und redet abwechselnd im Hintergrund weiter, was mich verwirrt. Sie hätten mit dem Arzt gesprochen, mehrmals. Sie sagen mir, was er gesagt hat. Die Worte flattern als leere bedeutungslose Buchstaben in mein Ohr und ohne Zwischenstopp im Gehirn auf der anderen Seite wieder heraus. Arzt. Bin ich krank? Was verdammt noch mal fehlt mir? Zumindest schon mal die Worte, um diesen abartigen Zustand, in dem ich mich seit gefühlter Ewigkeit befinde, auch nur annähernd beschreiben zu können. Ich weiß nur, dass sich der Gedanke, all das auch nur einen Tag, eine Stunde, eine Minute länger ertragen zu müssen, sich jeglicher Vorstellungskraft entzieht. Den einzigen zusammenhängenden Satz, den mein Sprachsteuerungszentrum im Laufe des Telefonats hervorbringt, ist: „Papa, ich kann nicht mehr.“ Als ich auflege, ohne ein Tschüss zu erwidern, ist sein Flug nach Singapur gebucht. Es gab keinen früheren als den in drei Tagen. 72 Stunden. 72 Stunden, die vor mir liegen, bis mich jemand retten kommt. Rettet wovor?
Nach zehn Jahren zahlloser Höhen und Tiefen, Fortschritten und Rückschlägen habe ich ein für mich gesundes Verhältnis zu meiner bipolaren Störung. Und die Erkenntnis, dass ich mich nicht nur trotz, sondern auch mit ihr gesund fühlen kann.
Teil 1 gibt’s hier.
Mehr über Lisa findet ihr in ihrem Blog:
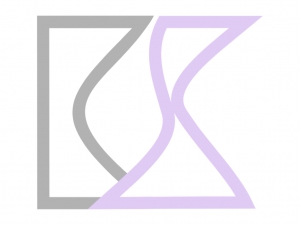


 Karina Sturm
Karina Sturm  Wiebke Klein
Wiebke Klein
 Jutta Jurenda
Jutta Jurenda




Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!